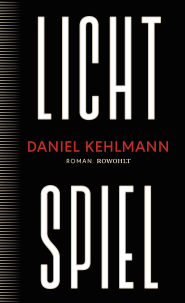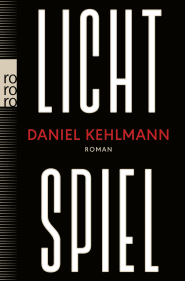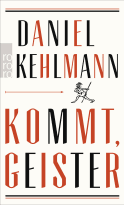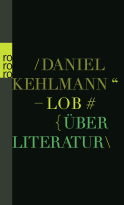«Bedenken Sie, was ich Ihnen bieten kann. Zum Beispiel KZ. Jederzeit.»
Daniel Kehlmanns großer neuer Roman über Kunst und Macht, Schönheit und Barbarei

Er war einer der bedeutendsten Regisseure des Kinos: Zur Machtergreifung dreht G. W. Pabst in Frankreich; vor den Gräueln des neuen Deutschlands flieht er nach Hollywood. Aber unter der blendenden Sonne Kaliforniens sieht er mit einem Mal aus wie ein Zwerg; nicht einmal Greta Garbo, die er unsterblich gemacht hat, kann ihm helfen. Und so findet Pabst sich, fast wie ohne eigenes Zutun, in seiner Heimat Österreich wieder, die nun «Ostmark» heißt. Obwohl er sich über die barbarische Natur des Regimes keine Illusionen macht, lässt er sich auf das Werben des Propagandaministers in Berlin ein. Der will das Filmgenie haben, er kennt keinen Widerspruch, und er verspricht viel. Während Pabst noch glaubt, dass er sich keiner Diktatur als der der Kunst fügen wird, ist er schon den ersten Schritt in die rettungslose Verstrickung gegangen ...
DAS INTERVIEW
Was hat Sie an der Geschichte von G. W. Pabst so sehr gereizt, provoziert oder herausgefordert, dass Sie ihn ins Zentrum Ihres neuen Romans «Lichtspiel» gestellt haben?
Erstens, er ist einer der wichtigsten Filmregisseure der frühen Zeit, einer der Pioniere des Films als eigenständiger Kunstform. Und zweitens, er hat diese ganz merkwürdige Emigrationsgeschichte eines Mannes, der bereits sicher in Amerika war und in Hollywood gearbeitet hat und sich dann plötzlich zu einer Rückkehr entschloss. Das ist sehr seltsam und verstörend, davon wollte ich erzählen.
Verdrängung, «innere Emigration», Überidentifikation, Kollaboration: Wo sehen Sie in diesem Spektrum den einst als «Roten Pabst» etikettierten Filmemacher, von dem es an an einer Stelle heißt, er sei «eigentlich aus Versehen», durch «eine Kette von Unglücksfällen» in Deutschland bzw. Österreich geblieben und nicht ins Exil gegangen?
Er ist ja sogar ins Exil gegangen – und dann zurückgekommen. Es ist also noch viel seltsamer, als man auf den ersten Blick meint. Und ja, keines der von Ihnen genannten Etiketten passt wirklich auf ihn, beschreibt sein Handeln und seinen Charakter. Deswegen war er für mich so faszinierend, dass ich ihn als Figur nacherfinden wollte. Denn «Lichtspiel» ist natürlich ein Roman, keine Biographie. So wie ich Lesern immer geraten habe, nicht «Die Vermessung der Welt» zu lesen, um etwas Gesichertes über den historischen Humboldt zu erfahren, so kann ich jetzt nur raten: Wer solide Fakten will, muss zu anderen Büchern greifen. Ein Roman ist das Feld des Möglichen und der Spekulation.
Neben anderen prominenten Zeitgenossen wie Zuckmayer, Mehring, Riefenstahl oder Rühmann taucht in «Lichtspiel» auch Fred Zinnemann auf, der ab den 1940er Jahren als Regisseur große Erfolge in Hollywood feierte: «Wir sind der Hölle entkommen. Eigentlich sollten wir uns den ganzen Tag freuen. Aber stattdessen tun wir uns leid, weil wir Western drehen müssen, obwohl wir allergisch gegen Pferde sind.» Ist das Zynismus oder bitter notweniger Pragmatismus angesichts der Brutalität der Verhältnisse?
Ich finde das gar nicht so zynisch. Zinnemann hat ja völlig recht. Und er hat ja dann tatsächlich mit «High Noon» den vielleicht besten Western aller Zeiten gedreht. Als ich diese Szene schrieb, dachte ich: Pabst sollte besser auf seinen Freund hören. Aber natürlich hätte es dann auch keinen Roman gegeben. Und ich habe übrigens auch keine Ahnung, ob der historische Fred Zinnemann allergisch auf Pferde war.
In Dominik Grafs Film «Jeder schreibt für sich allein» geht es um die Überlebensstrategien von Schriftstellern, die während der Nazizeit in Deutschland geblieben sind, Benn, Kästner, Fallada, Seidel, Vesper und andere. Graf warnt vor dem «selbstgerechten Furor der Nachgeborenen»: weil es fatal sei, «Kunstwerke an den Lebens-Fehlern ihrer Schöpferinnen und Schöpfer zu messen». Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ich sehe es ein wenig anders. Es ist nicht unbedingt selbstgerechter Furor, über die Entscheidungen von Menschen nachzudenken und sie zu bewerten. Es ist auch nicht selbstgerecht, über kleinliches und opportunistisches Verhalten empört zu sein. Wenn wir uns immer des Urteils enthalten würden, könnten wir ja nie aus der Geschichte lernen. Und wenn wir das eine oder andere Mal so abgestoßen vom Verhalten zum Beispiel eines Schriftstellers sind, dass wir dann gar keine Lust mehr haben, seine Bücher zu lesen, dann ist das nicht zwingend selbstgerechter Furor, sondern zunächst mal eine ganz normale menschliche Reaktion.
Ihr Roman ist dem im Mai 2023 in Miami vestorbenen Thomas Buergenthal gewidmet. Als Kind überlebte er Auschwitz, später war er Richter am Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und am Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Sie haben Buergenthal persönlich gekannt. Was hat Sie an ihm fasziniert?
Tom war der einzige Holocaust-Überlebende, den ich je kennengelernt habe, der seine Erlebnisse tatsächlich völlig bewältigt zu haben schien. Er konnte mit Klarheit und Gleichmut von Auschwitz erzählen, ohne blinde Flecken, ohne etwas wegschieben oder verdrängen zu müssen. Das hatte natürlich mit seiner Arbeit an Gerichtshöfen zu tun, die sich mit Kriegsverbrechen, Genozid und Ähnlichem beschäftigten – er hatte sein Leben der Bemühung gewidmet, dass sich so etwas, wie er es erlebt hatte, nie wiederholen sollte. Und dadurch konnte er es bewältigen. Ich habe ihm das Buch auch deshalb gewidmet, weil er während der Lektüre des Manuskriptes verstarb. Ich habe also nie erfahren, was er, dessen Meinung mir natürlich am allerwichtigsten gewesen wäre, von «Lichtspiel» gehalten hat.
Viele aus Ihrer Familie sind in Nazi-KZs umgekommen. Überlebt haben nur Ihre Großeltern, eine Tante und Ihr Vater. In einem Interview mit dem Magazin Cicero wurden Sie gefragt, ob Sie beabsichtigen, «sich irgendwann literarisch der Geschichte Ihrer Familie zu nähern». Kann es sein, dass Sie sich mit «Lichtspiel» ein Stück weit an dieses Kehlmann’sche Familienthema herangeschrieben haben?
Das kann ich selbst nicht gut beurteilen. «Lichtspiel» ist sicher ein Versuch, mich dieser Zeit zu nähern, sie erzählerisch zu verstehen – aber der Roman handelt von den Tätern und Mitläufern mehr als von deren Opfern. Das fand ich einfach erzählerisch interessanter, ergiebiger, natürlich in vieler Hinsicht auch schwieriger. Es ist nicht meine Familiengeschichte, aber es hat natürlich einiges mit ihr zu tun.
Nach zwei Jahren im abgespeckten Pandemieformat hat die Buchmesse im Oktober 2022 ihr Comeback gegeben. Dieses Jahr, heißt es, werde es in den Frankfurter Messehallen wohl rappelvoll. Wie sehr freuen Sie sich diesmal auf die Buchmesse, und das mit einem neuen Roman im Gepäck?
Ich freue mich sehr. Wenn ich an die letzten Jahre und die leeren Hallen und die immer halbleeren Veranstaltungssäle zurückdenke, kann ich nur sagen: Dieses Jahr werde ich mich nicht über Menschenmengen beschweren. Es ist schön, dass alles wieder ist, wie es vorher war.