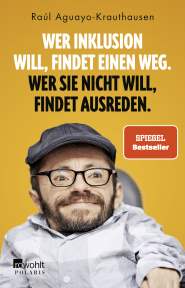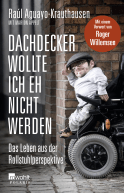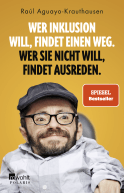
Nur die Begegnung bringt uns weiter!
«Wie schaffen wir es, eine neue Alltagskultur zu etablieren, die Menschen mit Behinderungen wertschätzt?»

Raúl Krauthausen ist der bekannteste Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit – und die lauteste Stimme in Deutschland, wenn es um die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen geht. Er erfand die Wheelmap, eine Karte für rollstuhlgerechte Orte, protestierte vor dem Bundestag für ein gutes Teilhabe- und Gleichstellungsgesetz, erwirkte eine Verfassungsklage gegen die Triage-Regelung und klärt u.a. in Blogartikeln, Fernsehbeiträgen und in seinen Podcasts über Behinderung auf. «Betrachten Sie Behinderung einfach als eine Eigenschaft wie die Haar- oder Augenfarbe» ist eine seiner zentralen Botschaften. In seinem neuen Buch wirft er grundlegende und oft unangenehme Fragen zur Inklusion in Deutschland auf, bringt seine Leser:innen dazu, sich mit ihrem eigenen Ableismus auseinanderzusetzen, und entwickelt eine Idee davon, wie Inklusion auf allen Ebenen wirklich zu leben ist.
Raúl Aguayo-Krauthausen über ...
- Inklusion
«Inklusion ist ein gesellschaftlicher Prozess, der uns alle etwas angeht und den wir alle gemeinsam gestalten. (…) Inklusion verfolgt einen radikal anderen Ansatz – es ist die Idee eines Systems, an dem alle Menschen gleichberechtigt teilhaben und selbstbestimmt zusammenleben. Das heißt nicht, dass Unterschiede ignoriert werden.»
- Schulformen
«Dass es neben allgemeinen Schulformen ein System extra für behinderte Menschen gibt, ist eine Form der Separation. Es werden Sonderräume geschaffen, die in sich geschlossen sind – das heißt, Behinderte sind dort ‹unter sich› und haben keinen oder nur sehr wenig Kontakt zu ihrer Umwelt und dem ‹allgemeinen› System. (…) Es reicht nicht, dass behinderte Kinder aus dem Sonderraum ‹Förderschule› auf eine ‹Regelschule› überführt werden und sich dort anpassen müssen, sondern die Idee der Inklusion besagt vielmehr, dass die unterschiedlichen Schulformen überflüssig sind, denn es gibt von vornherein nur eine Schule für alle, die sich den individuellen Bedürfnissen ihrer Schüler:innen anpasst.»
- Behindert werden statt behindert sein
«Statt den Fokus auf einen angeblichen Mangel zu legen, kann man die Funktionseinschränkung auch wertfrei als Teil dieser Person annehmen – sie ist in dieser Ansicht ein Merkmal wie die Augenfarbe. Die Person ist nicht behindert, sondern sie wird durch ihre Umwelt behindert, die individuelle Unterschiede nicht berücksichtigt. Wenn ich als Rollstuhlnutzer vor einer Treppe oder einem defekten Aufzug stehe und nicht weiterkomme, dann werde ich nicht durch meine Mobilitätseinschränkung behindert, sondern durch die Barrieren in der Welt.»
- Ableismus
«Das Wort Ableismus setzt sich aus dem englischen ‹able› («fähig») und dem deutschen ‹ismus› (eine Wortendung, die auf ein abstraktes, geschlossenes Gedankensystem verweist) zusammen. Es bezeichnet also die Bewertung von Menschen anhand ihrer Fähigkeiten – beziehungsweise die Erwartungshaltung, die an sie gestellt wird. Ableismus kann man nicht mit ‹Behindertenfeindlichkeit› gleichsetzen, denn das ist nur eine Facette des Phänomens. Durch die ständige Präsenz und Selbstverständlichkeit des Ableismus bilden viele behinderte Menschen auch eine Form dieses Phänomens aus, das sich gegen die eigene Person und Behinderung richtet: ‹internalisierter Ableismus›.»
- die Schonraumfalle
«Fahrdienste, Heime, Werkstätten und viele andere ‹Angebote› der Wohlfahrt tragen dazu bei, dass Menschen mit Behinderungen an die Ränder der Gesellschaft gedrängt werden. Die Wohlfahrtsindustrie hat eine ‹Schonraumfalle› geschaffen, in die Menschen mit Behinderungen abgeschoben werden. Wohlfahrtsverbände fahren millionenschwere Werbekampagnen, in denen sie darüber aufklären wollen, dass Menschen mit Behinderungen auch Menschen sind. Ich frage mich: Hat jemals ein:e Rassist:in allein durch seichte Aufklärungsarbeit grundlegend seine:ihre Einstellung verändert? Helfen uns Plakate voller lächelnder Gesichter, unterschrieben mit Binsenweisheiten, wirklich dabei, den Prozess der Inklusion voranzutreiben?»
- das Gelingen
«Damit Inklusion wirklich gelingen kann, brauchen wir eine Kultur, die behinderten Menschen auch das Gefühl vermittelt, dass sie selbstverständlicher Teil dieser Räume sind – sei es im Park, in der Straßenbahn oder woanders. (…) Es muss eine Kultur geben, die allen Menschen gleichermaßen vermittelt: «Ihr gehört dazu.› Dahinter steckt ein grundlegendes emotionales Bedürfnis – im Englischen als ‹Belonging› bekannt –, das alle Menschen teilen. (…) Es wird bestimmt durch eine Sicht auf Behinderung als etwas außerhalb der Norm – und das muss sich ändern. (…) Es gibt ein Zitat des spanischen Dichters Antonio Machado, das mir für den Abschluss dieses Buches passend erscheint: ‹Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.› Nur wenn wir Inklusion als aktiven Prozess begreifen und anfangen, neue Wege zu bahnen, dann kommen wir voran.»
Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden.
Raúl Krauthausen ist der bekannteste Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit – und die lauteste Stimme in Deutschland, wenn es um die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung geht. «Betrachten Sie Behinderung einfach als eine Eigenschaft wie die Haarfarbe» ist ein ...
Wer Inklusion will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden.
Raúl Krauthausen ist der bekannteste Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit – und die lauteste Stimme in Deutschland, wenn es um die Durchsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderung geht. «Betrachten Sie Behinderung einfach als eine Eigenschaft wie die Haarfarbe» ist ein ...