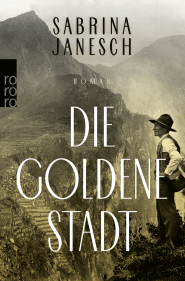Die verlorene Stadt der Inka
Im Interview: Sabrina Janesch über den Abenteurer und Machu-Picchu-Entdecker Augusto R. Berns

Peru, 1887. Das ganze Land redet von einem Mann – und seiner großen Entdeckung: Augusto Berns will die verlorene Stadt der Inka, versteckt im Dschungel der Cordillera Vilcabamba, gefunden haben. Alles beginnt mit einem Jungen, der am Rhein Gold wäscht, und mit dessen Entschluss: die legendenumwobene goldene Stadt finden. Berns wagt die Überfahrt nach Peru, wo er eher zufällig zum Helden im Spanisch-Südamerikanischen Krieg wird, dann als Ingenieur der Eisenbahn Mittel für seine Expedition sammelt. Mit dem amerikanischen Abenteurer Harry Singer besteigt er auf der Suche nach El Dorado die Höhen der Anden und schlägt sich durch tiefsten Dschungel – um schließlich an einen Ort zu gelangen, der phantastischer ist als alles, was er sich je vorgestellt hat …
Erst seit kurzem weiß man, dass das sagenumwobene Machu Picchu in Peru von einem Deutschen entdeckt wurde. Sabrina Janesch hat sich auf die Spuren des vergessenen Entdeckers begeben und erzählt seine aufregende Geschichte. «Die goldene Stadt» ist ein Roman von großer literarischer Kraft, der uns in eine exotische Welt eintauchen lässt – und zeigt, was es bedeutet, für einen Traum zu leben.
Sten Nadolny: «Makellos geschrieben, fesselnde Figuren, Reichtum, wohin man sieht – plastisch, farbig und unvergesslich.»
Alberto Manguel: «Sabrina Janesch hat einen großen Abenteuerroman geschrieben, phantastisch anmutend und doch historisch wahr – eine Hommage an die Grenzenlosigkeit der menschlichen Neugier.»
Das Interview
Zunächst einmal: Herzlichen Glückwunsch zum Annette-Droste-von-Hülshoff-Preis 2017! Die Jury zeigte sich beeindruckt von Ihrem ganz eigenen Weg eines vitalen, historisch fundierten Erzählens. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung?
Vielen Dank! Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Der Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis geht auf eine lange Tradition zurück, und obwohl in Westfalen verwurzelt, hat er doch eine bundesweite Strahlkraft. So großartige Autoren wie Sarah Kirsch, Hans-Ulrich Treichel oder Tilman Rammstedt haben ihn bereits für herausragende Leistungen bekommen. In diese Reihe eingeordnet zu werden, ist eine große Ehre.
Ich habe «Die Goldene Stadt» gelesen wie einen der klassischen Abenteuerromane meiner Kindheit und Jugend: in einem Rutsch, wie im Rausch. Das liegt an der bildgewaltigen Sprache, den kraftvollen Figuren, den intensiven Landschaftsbeschreibungen. Man könnte meinen, Abenteuerbücher seien vor allem «Jungsbücher»: von «großen Jungs» geschrieben für ein überwiegend männliches Publikum. Haben Sie schon als Mädchen Abenteuerbücher geliebt?
Genau so sollte Lesen doch auch sein, oder? – Ein Rausch, ein Rutsch, ein Taumel. So habe ich auch gelesen, als Kind zumindest, und viele der damaligen Lektüreerfahrungen sind für mich die intensivsten gewesen. Zu meinen Lieblingsbüchern als Kind zählten – seit dem Zeitpunkt, da ich sie mühsam Wort für Wort entzifferte – Stevensons «Die Schatzinsel», Jack Londons «Ruf der Wildnis» und «Wolfsblut», Conan Doyles «Die Vergessene Welt».
Viele Ihrer Leser*innen werden die Anden nur aus Filmen (wie Werner Herzogs «Fitzcarraldo») oder Büchern (wie Eduardo Galeanos «Die offenen Adern Lateinamerikas») kennen. Sie dagegen haben Peru bereist, haben vieles von dem, was Ihre Figur Augusto Berns erlebt, selbst dort gesehen. Worin besteht für Sie der einzigartige Reiz von Machu Picchu?
Machu Picchu, das ist mehr als die Ansammlung vor Jahrhunderten zusammengefügter Granitquader. Gelegen im Herzen der Cordillera Vilcabamba, in einer unzugänglichen, weil quasi vertikalen Region der peruanischen Anden – noch dazu erbaut auf einem schmalen Sattel zwischen zwei Gipfeln – ist es Symbol einer übermenschlichen Anstrengung, einer Manie. Machu Picchu ist ein Wahnwitz, in einer der faszinierendsten Gegenden, die man bereisen kann.
In Ihren ersten Romanen spielt die polnische Seite Ihres Lebens eine große Rolle: die schlesische Kindheit, Danzig. Mit der «Goldenen Stadt» haben Sie sich bewusst für ein anderes literarisches Terrain entschieden. War der Aufsehen erregende Artikel in der Süddeutschen Zeitung («Hat ein Deutscher Machu Picchu entdeckt?») tatsächlich der finale Anstoß für den Roman?
Diese Meldung war der finale Anstoß – aber nicht mehr als das. Als ich diese Nachricht las, war ich bereits mehrfach in Südamerika gewesen, zweimal in Peru, und hegte längst eine Liebe für dieses Land und seine Kultur. Ich hatte mehrere Bücher von Hiram Bingham gelesen, kannte also die bis dato erforschte Geschichte Machu Picchus. In gewisser Weise fiel also die Nachricht über den mysteriösen Deutschen A. R. Berns auf fruchtbaren, bereiteten Boden. Ich wollte seine Geschichte lesen. Es gab sie nicht; also schrieb ich sie.
Ob «Katzenberge», «Ambra», «Tango für einen Hund» oder jetzt «Die goldene Stadt»: Immer wieder wird Ihre literarische Handschrift als «magischer Realismus» beschrieben. Können Sie mit diesem Etikett etwas anfangen?
Da viele der Werke von Garcia Márquez und Borges zu meinen Lieblingsbüchern zählen: sicher, mit dem Etikett kann ich etwas anfangen. Moment: Das ist untertrieben. Die magischen Bestandteile einer Erzählung – und die können auch sehr nüchtern und unaufgeregt daherkommen – fesseln mich besonders. Solche Bestandteile sind sicher auch in meinen Romanen zu finden. Andererseits: Wo ein Etikett klebt, da verdeckt es auch etwas. Am Ende ist es eben doch nicht mehr als genau das: ein Etikett auf etwas, das viel uneindeutiger und vielschichtiger ist.
Apropos magischer Realismus: Wo zwischen Gabriel Garcia Marquez' Großepos «Hundert Jahre Einsamkeit» und Daniel Kehlmanns «Die Vermessung der Welt» würden Sie, was den Umgang mit dem historischen Material angeht, Ihren neuen Roman einordnen?
Eine schwierige Frage. Im Roman entspricht zugleich alles der Wahrheit und doch gleichzeitig nichts. Die Parameter von Berns’ Leben – Jahreszahlen, Aufenthaltsorte, Tätigkeiten, Partner – entspringen meiner Recherche. All das aber, was Berns als Menschen, als Charakter ausgemacht hat, seine Visionen, seine Obsession, seine unermüdliche Energie, das entstammt meiner eigenen Fantasie. Seine Nöte, Probleme, Gedankengänge habe ich ihm eingeschrieben. Somit sind sie höchst unhistorisch. Am liebsten halte ich es wie T. C. Boyle, der sich genussvoll von historischen Fakten inspirieren, aber niemals einengen lässt.
Es lohnt, die Danksagung am Ende Ihres Romans zu lesen. Sie müssen Jahre recherchiert haben, zwischen Dültgensthal und Solingen und zwischen Berlin, Brooklyn und Cuzco. Sie dürften mehr über die historische Figur Rudolph bzw. Augusto Berns wissen als irgendjemand sonst. Wie beurteilen Sie den – sagen wir: arg kargen und zugleich hochgradig spekulativen – Wikipedia-Eintrag zu Augusto Berns?
Der Wikipedia-Eintrag wie auch die wenigen Informationen, die über Berns im Internet kursieren, sind leider unvollständig, veraltet oder überholt. Sie gründen auf kurze Artikel, etwa in der Süddeutschen, die ein Interview paraphrasieren, das Paolo Greer in der Anfangsphase seiner Recherche gegeben hat. Seither hat sich viel getan in der Forschung zur Causa Berns; nicht zuletzt durch meine eigene Recherche (aus der später der Roman wurde) und die von Daniel Buck. Berns als Goldschürfer zu titulieren wirkt etwas unbeholfen: Wenn man ihn auf etwas festlegen müsste, so wäre er eher Ingenieur und Unternehmer. Und nicht zuletzt Entdecker.
Außerdem findet sich immer wieder – auch bei Wikipedia – die Behauptung, dass Berns bereits 1867 Machu Picchu gefunden haben soll; dies ist ein Irrtum. 1867 hat Berns noch bei der Eisenbahn gearbeitet, in die Gegend von Machu Picchu kam er erst um 1876.
Der Roman endet mit einer (hinreißend beschriebenen) Begegnung zwischen Augusto Berns und dem US-Archäologen Hiram Bingham 1911 in den Anden. Eine Frage bleibt offen: Gab es sie überhaupt, die mythischen Goldschätze im peruanischen Dschungel? Hat der historische Berns tatsächlich die Schätze der Inka-Bauten von Machu Picchu geplündert und in alle Welt verkauft, wie es sowohl der SZ-Artikel als auch der Wikipedia-Eintrag behaupten? Die Forschungsergebnisse der beiden Historiker Paolo Greer und Carlos Carcelén sind nicht unumstritten …
Mittlerweile gilt es als gesichert, dass Machu Picchu eine Art Landsitz des Inka Pachacútec Yupanqui war, und somit per se keine großen Goldansammlungen aufweisen konnte. Selbst wenn Berns gewollt hätte: Es hätte herzlich wenig zu plündern gegeben. Auch Paolo Greer, der 2008 die Vermutung geäußert hatte, Berns könne Machu Picchu geplündert haben, nimmt mittlerweile Abstand von dieser Behauptung.
Sehr wahrscheinlich ist meiner Meinung nach, dass Berns die gleiche Erfahrung gemacht hat wie Hiram Bingham fünfunddreißig Jahre später, in 1911: Er fand eine – was Gold und generell Artefakte anbelangte – quasi besenreine Ruine vor. Fakt ist: Die Ruine, die wir Machu Picchu nennen, war den Einheimischen stets bekannt gewesen. Falls es doch Gold, oder irgendetwas von Interesse gegeben haben sollte, wäre es bereits vor Jahrhunderten «verschwunden».
Sie waren die erste Stadtschreiberin von Danzig. Das klingt unheimlich romantisch: Schreibzimmer in einem Türmchen, morgens stellen freundliche Einheimische selbstgebackenes Brot und einen Krug frischer Milch vor der Tür ab ... Wie lebt es sich wirklich als Stadtschreiberin, wie sieht es mit den Rechten und Pflichten dieses «Amtes» aus?
Einiges daran war wirklich romantisch: Ich bewohnte ein Zimmerchen in der Mansarde eines Stadthauses, mit direktem Blick auf die Marienkirche. Im Sommer wehten Möwen vorbei, im Herbst die Ostseenebel. Ich schrieb viel und gerne. Neben den Skizzen zum Roman «Ambra», den ich damals vorbereitete, gab es tatsächlich allerlei Pflichten und Aufgaben. Als deutsche Stadtschreiberin in Danzig hatte ich eine Art Botschafter-Funktion inne, hielt Vorträge, gab Kommentare – 2009 jährte sich der Beginn des Zweites Weltkriegs zum 70. Mal –, nahm an Konferenzen und Podiumsdiskussionen teil. Das ist acht Jahre her, damals war ich 24. Und unerschrocken.
In einem Interview haben Sie einmal auf die Frage, warum Sie schreiben, eine großartige Antwort gegeben: «Weil ich Geschichten erzählen möchte, vom Reden aber unheimlich schnell heiser werde …» Was macht das Stimmtraining für die große Lesereise mit der «Goldenen Stadt» – muss man sich Sorgen um Ihre Stimme machen?
Keineswegs! Im Übrigen habe ich die Erfahrung gemacht: Es fällt alles auf die Atmung zurück. Bei Lesungen wie bei buchstäblich allem anderen. Hat man die im Griff, ist der Tag eigentlich schon gewonnen.
Zum Schluss möchten wir Sie noch um eine kleine Buchempfehlungsliste bitten. «Die Goldene Stadt» ist gesetzt, ebenso – wie wir aus sicherer Quelle wissen – Michail Bulgakows schönster Roman «Meister und Margarita». Ein paar Titel, die man unbedingt lesen sollte, wären zum Beispiel …
«Der Tod des Iwan Iljitsch» von Tolstoi. «Meister und Margarita» von Bulgakow. «Wassermusik» von T.C. Boyle. «Die Entdeckung der Langsamkeit» von Sten Nadolny. «Maytas Geschichte» von Mario Vargas Llosa. «Die wilden Detektive» von Bolaño. Und noch ein Buch, das ich sehr liebe: «Tortilla Flat» von John Steinbeck. Das sind alles sehr unterschiedliche Bücher, wie ich gerade sehe – gut, oder?
Die goldene Stadt
Peru, 1887. Das ganze Land redet nur von einem Mann – und seiner großen Entdeckung: Augusto Berns will die verlorene Stadt der Inka gefunden haben. Das Medienecho reicht von Lima bis London. Doch wer ist der Mann, der vielleicht El Dorado entdeckt hat? Alles beginnt mit einem ...
Die goldene Stadt
Peru, 1887. Das ganze Land redet nur von einem Mann – und seiner großen Entdeckung: Augusto Berns will die verlorene Stadt der Inka gefunden haben. Das Medienecho reicht von Lima bis London und New York. Doch wer ist der Mann, der vielleicht El Dorado entdeckt hat? Alles beginnt ...
Die goldene Stadt
«Makellos geschrieben, fesselnde Figuren, Reichtum, wohin man sieht – plastisch, farbig und unvergesslich.» Sten Nadolny über «Die goldene Stadt»
«Sabrina Janesch hat einen großen Abenteuerroman geschrieben, phantastisch anmutend und doch historisch wahr – eine Hommage an die ...