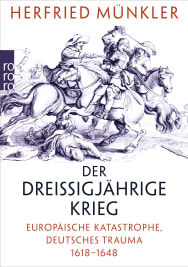Als am 23. Mai 1618 protestantische Adelige die Statthalter des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II. aus den Fenstern der Prager Burg stürzten, war kaum abzusehen, was folgen sollte: ein Flächenbrand, der längste und blutigste Religionskrieg der Geschichte, der erste im vollen Sinne «europäische Krieg». Fesselnd erzählt Herfried Münkler vom Schwedenkönig Gustav Adolf und dem Feldherrn Wallenstein, von Kardinälen und Kurfürsten, von den Landsknechten und den durch Krieg und Krankheiten verwüsteten Landschaften Deutschlands. Auch die europäische Staatenordnung lag in Trümmern – und doch entstand auf diesen Trümmern eine wegweisende Friedensordnung, mit der eine neue Epoche ihren Ausgang nahm. Münkler führt auf fast 1000 Seiten den Dreißigjährigen Krieg in all seinen Aspekten vor Augen. Und begründet, warum er besser als alle späteren Konflikte die heutigen Kriege verstehen lässt.
Ein Krieg, der nicht enden will
Geschichtsschreibung und politische Analyse in einem: Herfried Münklers brillante Gesamtdarstellung des Dreißigjährigen Kriegs

Das Interview
Es gibt eine Reihe literarischer Zeugnisse, in denen der Dreißigjährige Krieg mehr als nur eine periphere Rolle spielt: Grimmelshausen, Gryphius, Schiller, Ricarda Huch, Bert Brecht, Golo Mann, zuletzt Daniel Kehlmann mit seinem Roman «Tyll». Wie lesen Sie als historisch versierter Politikwissenschaftler solche Werke? Wie intensiv nützen Sie Quellen aus Literatur und Kunst für Ihre wissenschaftliche Arbeit?
Es sind recht unterschiedliche Zeugnisse, die Sie hier aufgeführt haben: Grimmelshausen ist fast ein Dokument über die Verarbeitung des Krieges, bei Gryphius ist das ebenso. Beide Autoren habe ich mit ihren jeweiligen Sichtweisen fast im Sinne von Quellen benutzt. Schiller dagegen ist in seiner «Geschichte des Dreißigjährigen Krieges» einer der großen Historiker dieses Krieges, der ihn bis auf die Reformation zurückführt. Ricarda Huch dagegen, ausgebildete Historikerin, stellt ihn eher als eine Abfolge von Episoden dar, Bert Brecht nutzt die Vorgaben Grimmelshausens, um daraus eine spezifische Sicht des Krieges zu gewinnen, verfremdende Kritik der Kriege seiner Zeit. Golo Mann sollte man wohl als Historiker behandeln, und Daniel Kehlmann hat sich in seinem Roman «Tyll» die Freiheit genommen, eine Gestalt, die literarisch zwei Jahrhunderte älter ist, in diesen Krieg zu versetzen, um an unterschiedlichen Schauplätzen präsent sein zu können und doch eine durchgängige Handlungslinie zu haben. Also: Grimmelshausen und Gryphius geben mir Einblick in spezifische Formen der Wahrnehmung und mentalen Verarbeitung des Krieges, Schiller, Huch und Brecht sind Darstellungen und Bearbeitungen unter spezifischen Gesichtspunkten. Die habe ich natürlich immer im Auge gehabt, weil die Geschichte dieses Krieges immer auch die Geschichte seiner Darstellungen ist – jedenfalls im Hinblick auf die Wahrnehmung des Krieges bei den Deutschen.
Die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg beschreiben Sie als das «große Trauma der Deutschen», bevor es von der mit den beiden Weltkriegen verbundenen Gewalt und Verwüstung abgelöst wurde. «Die den Deutschen angetane Gewalt wurde zur Rechtfertigung für die nunmehr von den Deutschen den anderen zugefügte Gewalt» – diese Haltung war bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs eine dominante Position. Knüpft die revisionistische Historiografie von heute an diesem «Opfernarrativ» an?
Also zunächst einmal beschäftige ich mich mit der Wahrnehmung des Krieges, die in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland dominierte: Gustav Freytag spielte da eine wichtige Rolle. Was vorherrschte, war das Opfernarrativ, und das hatte zur Folge, dass die Vorstellung verbreitet war, unter keinen Umständen dürfe man ein zweites Mal zum Opfer werden. Daraus folgte dann noch mehr, nämlich die prinzipiell offensiven Kriegsplanungen des Generalstabs, mit denen vermieden werden sollte, dass ein weiteres Mal ein europäischer Krieg – und solches war der Erste Weltkrieg sicherlich – auf deutschem Boden geführt wurde. Das war eine Form, die man für «Lernen aus dem Kriege» hielt, von der wir aber heute sagen können, dass damals nichts anderes als Falsches gelernt worden ist. Was die Frage nach der revisionistischen Historiographie anbetrifft: Ja, ich misstraue Opfernarrativen ebenso wie ich der von Fritz Fischer entworfenen Konstruktion, wonach Deutschland beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges an allem Schuld gewesen sei, misstraut habe. Das ist etwas anderes beim Zweiten Weltkrieg: Da gibt es keine Frage, dass Hitler den Krieg gewollt und ihn vom Zaun gebrochen hat. 1914 war das indes anders. Ich setze da eher auf eine Kombination von nüchterner Analyse der Handlungsketten auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen kritischen Blick auf die großen Narrative, die häufig politischen Zwecken dienen.
«Der Blick auf den Dreißigjährigen Krieg lehrt politischen Realitätssinn»
Die «Westfälische Ordnung» von 1648 hat den «großen Krieg» reguliert, indem sie ihn einer an Staatsinteressen orientierten Rationalität unterwarf. An die Stelle marodierender Söldnertrupps traten reguläre Armeen, zwischen Kombattanten und Nicht-Kombattanten wurde klar unterschieden. Wie kommt es, dass selbst Politiker aus den aktuellen Kriegsgebieten des Nahen Ostens immer wieder von der Notwendigkeit eines «Westfälischen Friedens» für ihre Region sprechen?
Vermutlich hat das Missverstehen des Westfälischen Friedens bei vielen Politikern damit zu tun, dass der Friedensschluss von Münster und Osnabrück von beiden Städten inzwischen nur noch als die Beendigung eines großen Krieges dargestellt wird und die Dimension der neuen Kriegsregulation weitgehend ausgeblendet bleibt. Das ist eines der politischen Selbstverständigungsnarrative der Bundesrepublik, das in diesem Falle dazu führt, dass man letzten Endes wenig weiß über das, was der Fall gewesen ist. Aber für den Nahen Osten, wo Volksaufstand und Religionskrieg, Hegemonialkrieg und Kampf um die Ordnung des Raumes zusammenfließen, wäre eine Regulation im Sinne der Westfälischen Ordnung sicherlich eine Besserung.
Beim Lesen des Schlusskapitels – «Der Dreißigjährige Krieg als Analysefolie» – ist mir nicht klar geworden, welche Schlüsse aus den konstatierten «Strukturanalogien» zwischen dem Dreißigjährigen Krieg und den blutigen Konflikten im Vorderen Orient und der Sahel-Zone für die praktische Politik zu ziehen sind. Was zum Beispiel könnte die Weltordnungs- und Weltinterventionsmacht USA aus dem Dreißigjährigen Krieg lernen?
Ich fürchte, dass die USA nicht mehr die Weltordnungs- und Weltinterventionsmacht sind, wie Sie das in Ihrer Frage annehmen. Bereits unter Barack Obama hat ein Rückzug aus dieser Rolle stattgefunden, und Donald Trumps Formel «America First» ist ja nichts anderes als eine Formulierung dieses Rückzugs aus Gemeinaufgaben. Insofern haben die USA wenig Motivation, irgendetwas aus diesem Krieg zu lernen, der ja auch in einer Zeit stattgefunden hat, in der es die USA noch gar nicht gab, sondern sie noch in den Anfängen der Kolonisation steckten.
Die Europäer können daraus einiges lernen, nämlich, dass dann, wenn es nicht gelingt, die Konfliktherde Nordirak und Syrien auf der einen und Jemen auf der anderen Seite und schließlich auch noch Libyen voneinander getrennt zu halten, sondern diese zu einem einzigen großen Krieg werden, wie man das in den ersten zehn Jahren des Dreißigjährigen Krieges beobachten kann, sie mit einem Krieg konfrontiert sein werden, der ausbrennen muss, weil niemand in der Lage ist, ihn angesichts der Überlagerung unterschiedlichster Motive zu beenden. Das ist die erste Konsequenz, die eher bitter ist. Die zweite ist, dass man nur in langen, mühseligen Verhandlungen, die sich über Jahre hinziehen, zu einem Friedensschluss kommen wird, dass man sich bei diesen Verhandlungen darauf einstellen muss, dass dies alles nur gelingen kann, wenn man einen so überragenden Vermittler hat, wie dies Graf Maximilian von Trautmannsdorff in der Verhandlung des Westfälischen Friedens gewesen ist usw. Der Blick auf den Dreißigjährigen Krieg lehrt politischen Realitätssinn.
Glaubenseifer und Machtpolitik
Würden Sie eine Unterrichtseinheit zum Dreißigjährigen Krieg für die Schule konzipieren – worauf würden Sie das Augenmerk richten? Was würden Sie jungen Menschen erklären, deren Geschichtsbewusstsein bestenfalls mit dem Ersten Weltkrieg einsetzt?
Vermutlich würde ich mir die Akteure vornehmen, auf der einen Seite die einfachen Soldaten, Abenteurer, die in den Krieg gezogen sind, weil ihnen das bürgerliche Leben zu langweilig war, aber auch arme Bauern, die, marodierender Soldateska ausgesetzt, lieber Soldaten wurden, um Täter zu sein, damit sie nicht Opfer werden. Und dann würde ich daneben die großen Offiziere und Warlords stellen, einen romantischen Ritter wie Christian von Braunschweig und einen eiskalten Unternehmer wie Ernst von Mansfeld, den klugen und skrupellosen Wallenstein und daneben den Schwedenkönig Gustav Adolf, in dessen Agieren Glaubenseifer und Machtpolitik zusammenfallen, um darüber so etwas wie Empathie und Sensibilität für das Geschehen zu entwickeln. Danach kann man sich die einzelnen Etappen des Krieges ansehen.
Am Ende des Buches danken Sie Ihrer Frau Prof. Dr. Marina Münkler, die als erste kritische Leserin die ganze Wegstrecke über dabei war. Und der Carl Friedrich von Siemens Stiftung, die Ihnen über ein einjähriges Siemens-Fellowship ideale Arbeitsbedingungen geboten hat. Worin lag der der Reiz dieser Münchner writer's residence? Wie wichtig war es, für ein Jahr von allen akademischen Verpflichtungen an der Humboldt-Universität in Berlin entbunden zu sein?
Nun denn, der Reiz lag darin, dass ich den ganzen Tag von morgens um 7 bis abends zumindest nach 20 Uhr nichts anderes getan habe, als mich mit dem Konzipieren und Schreiben des Textes zu beschäftigen. Es gab also keine störenden Interventionen, die meine Aufmerksamkeit auf anderes gerichtet haben, wie das im universitären Alltag der Fall ist. Wenn man innerhalb eines Jahres tendenziell 1000 Seiten über ein so komplexes Themenfeld wie dem Dreißigjährigen Krieg zu Papier bringen will, ist das wohl eine zwingende Voraussetzung fürs Fertigwerden. Das Risiko dieser «Einsamkeit und Freiheit» im Sinne Wilhelm von Humboldts ist, dass man ganz allein ist, dass man mit Vereinsamung zu tun hat und ähnliches mehr. Da meine Frau aber häufig in München war, hat sie die Sozialität dargestellt, sie war meine Gesprächspartnerin im Hinblick auf das Thema, aber auch im Hinblick auf alles andere, was nicht mit dem Thema zusammenhing, und obendrein hat sie eine Lebensfreude in die Wohnung gebracht, die der Gegenstand des Buches nicht hergeben konnte. Es war also eine glücklich ausbalancierte Konstellation, in der ich mich in München befunden habe; sie war die Voraussetzung dafür war, das Projekt hinzubekommen.
Der Dreißigjährige Krieg
Als am 23. Mai 1618 protestantische Adelige die Statthalter des römisch-deutschen Kaisers Ferdinand II. aus den Fenstern der Prager Burg stürzten, konnte niemand ahnen, was damit seinen Anfang nahm: der längste Krieg auf deutschem Boden, zugleich der erste «europäische Krieg». Fesselnd erzählt Herfried Münkler vom Schwedenkönig Gustav Adolf, von großen Feldherrn wie Wallenstein oder Tilly, von geschickter Bündnispolitik, dramatischen Schlachten und einer nie dagewesenen Gewalt. Dabei behält er unsere Zeit im Blick: Besser als alle späteren Konflikte läßt uns dieser die Kriege der Gegenwart verstehen. Münklers Bestseller wurde von der Presse als neues Standardwerk gefeiert.