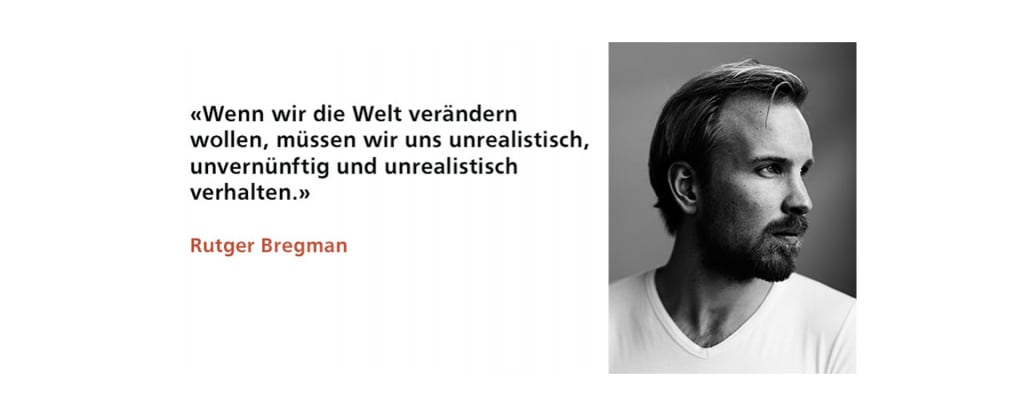Die Rückkehr der Utopie. «Wenden wir uns wieder dem utopischen Denken zu. Wir brauchen einen neuen Leitstern, eine neue Karte der Welt, auf der wir wieder einen fernen, unentdeckten Kontinent eintragen können, einen Kontinent namens Utopia. Damit meine ich keinen starren Plan von der Art, die uns die utopistischen Fanatiker mit ihren Theokratien oder Fünfjahresplänen aufzuzwingen versuchen – sie unterwerfen lediglich reale Menschen ihren Fieberträumen. (…) Eines steht fest: Ohne all die idealistischen Träumer, die es zu allen Zeiten gab, wären wir immer noch arm, hungrig, schmutzig, ängstlich, dumm, krank und hässlich. Ohne Utopie sind wir verloren. Nicht, dass die Gegenwart schlecht wäre, im Gegenteil. Aber es ist eine freudlose Gegenwart, wenn wir nicht darauf hoffen dürfen, dass die Zukunft besser sein wird. ‹Der Mensch braucht zu seinem Glück nicht nur diesen oder jenen Genuss, sondern Hoffnung, neue Unternehmungen und Veränderung›, schrieb der britische Philosoph Bertrand Russell.»
Warum wir jedermann Geld schenken sollten. «Studien aus aller Welt belegen: Geschenktes Geld funktioniert. Es liegen bereits Forschungsergebnisse vor, die zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen auflagenfreien Zuschüssen und einer Verringerung von Kriminalität, Kindersterblichkeit, Mangelernährung, Teenagerschwangerschaften und Schulabwesenheit sowie einer Steigerung der schulischen Leistungen, des Wirtschaftswachstums und der Gleichberechtigung der Geschlechter gibt. (…)
Geschenktes Geld: Diesen Vorschlag haben bereits einige der größten Denker in der Menschheitsgeschichte gemacht. Thomas More träumte im Jahr 1516 in seinem Buch Utopia davon. Ungezählte Ökonomen und Philosophen, darunter einige Nobelpreisträger, folgten seinem Beispiel. Befürworter dieser Idee finden sich im gesamten politischen Spektrum, darunter die Väter der neoliberalen Schule, Friedrich Hayek und Milton Friedman. Und Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) enthält das Versprechen, dass es eines Tages kommen wird. (…) Die Zeit ist reif für das bedingungslose Grundeinkommen.»
Krieg gegen die Armen. «Das gegenwärtige bürokratische Gewirr hält die Menschen in der Armut gefangen, ja es macht sie abhängig. Während Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt ihre Stärken zeigen sollen, erwarten die Sozialdienste von Hilfeempfängern, ihre Defizite nachzuweisen, ein ums andere Mal zu belegen, dass eine Krankheit sie tatsächlich arbeitsunfähig macht, dass sie durch eine Depression ausreichend behindert werden und dass ihre Aussichten auf einen Arbeitsplatz wirklich miserabel sind. Gelingt ihnen der Nachweis ihrer Untauglichkeit nicht, werden ihnen die Leistungen gekürzt. Formulare, Interviews, Kontrollen, Einsprüche, Bewertungen, Konsultationen und noch mehr Formulare: Für jeden Antrag auf Unterstützung gibt es ein entwürdigendes Verfahren, das sehr viel Geld verschlingt. «Privatsphäre und Selbstachtung werden auf eine Art und Weise mit Füßen getreten, die für jemanden außerhalb des Sozialhilfesystems unvorstellbar ist», erklärt ein britischer Sozialarbeiter. «Es wird ein giftiger Nebel des Misstrauens erzeugt.»
Das ist kein Krieg gegen die Armut, sondern ein Krieg gegen die Armen.»
Die 15-Stunden-Woche. «Hätte man den bedeutendsten Ökonomen des 20. Jahrhunderts nach der größten Herausforderung im 21. Jahrhundert gefragt, so hätte er nicht zweimal überlegen müssen. Er hätte die Freizeit genannt. Im Sommer 1930, als sich die Weltwirtschaftskrise gerade festsetzte, hielt der britische Ökonom John Maynard Keyneseinen ungewöhnlichen Vortrag in Madrid. (…) Ausgerechnet in einer Stadt, die am Abgrund stand, wagte es der britische Ökonom, eine anscheinend abwegige Prognose anzustellen. Im Jahr 2030, erklärte Keynes, werde die Menschheit mit der größten Herausforderung in ihrer Geschichte konfrontiert sein: Was sollten die Menschen mit all der Freizeit anfangen? Sofern die Politiker nicht «katastrophale Fehler» begingen – zum Beispiel Austerität in einer Wirtschaftskrise – , werde der westliche Lebensstandard innerhalb eines Jahrhunderts das Niveau des Jahres 1930 mindestens um das Vierfache übersteigen. Das Ergebnis? Im Jahr 2030 würden wir nur noch fünfzehn Stunden in der Woche arbeiten. (…)
Freizeit – weder Luxus noch Laster. «Freizeit ist für unser Gehirn so wichtig wie Vitamin C für unseren Körper. Es gibt nicht einen Menschen auf der Erde, der auf seinem Totenbett denkt: ‹Hätte ich doch nur ein paar Überstunden mehr gemacht oder ein paar Stunden länger vor dem Fernseher gesessen.› Es stimmt, dass es nicht leicht sein wird, in einem Meer von Freizeit zu schwimmen. Das Bildungssystem des 21. Jahrhunderts sollte die Menschen nicht nur auf das Erwerbsleben, sondern auch und vor allem auf das Leben vorbereiten. ‹Wenn die Menschen nicht mehr müde in ihre Freizeit hineingehen›, schrieb der Philosoph Bertrand Russell im Jahr 1932, ‹dann wird es sie auch bald nicht mehr nach passiver und geistloser Unterhaltung verlangen.› Wir können das gute Leben durchaus bewältigen, wenn wir uns nur die Zeit dazu nehmen.»
Offene Grenzen. «In einer Welt, in der eine absurde Ungleichheit herrscht, ist die Migration das beste Werkzeug im Kampf gegen die Armut. Woher wir das wissen? Aus Erfahrung. Als Irland in den fünfziger und Italien in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts in Armut versanken, verließen die meisten armen Bauern diese Länder, und das Gleiche taten 100 000 Niederländer zwischen 1830 und 1880. Das Ziel all dieser Menschen war das Land jenseits des Ozeans, in dem scheinbar unbegrenzte Möglichkeiten auf sie warteten. Das reichste Land der Welt, die USA, wurde von Einwanderern aufgebaut. (…)
Vielleicht werden wir in hundert Jahren so auf diese Grenzen zurückblicken, wie wir uns heute an die Sklaverei und die Apartheid erinnern. Aber eines ist sicher: Wenn wir die Welt zu einem besseren Ort machen wollen, führt kein Weg daran vorbei, die Grenzen für die Migration zu beseitigen. Es würde schon helfen, die Tür einen Spaltbreit zu öffnen. Würden alle entwickelten Länder nur 3 Prozent mehr Einwanderer aufnehmen, so hätten die Armen der Welt 305 Milliarden Dollar mehr zur Verfügung, erklären Experten der Weltbank. Das ist mehr als das Doppelte der gesamten gegenwärtigen Entwicklungshilfe.»